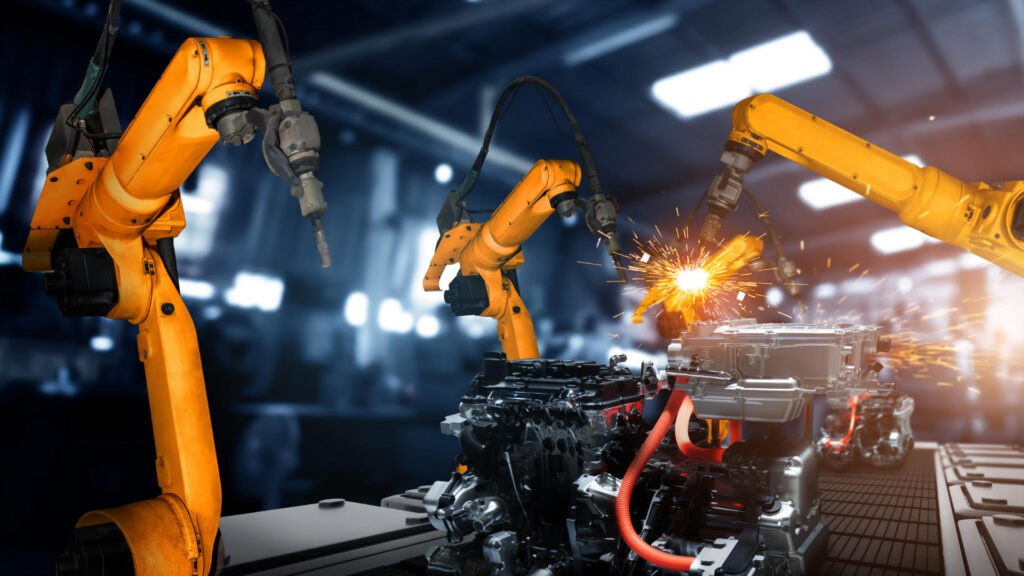- Perspektive - Beitrag
Wie konsequente Digitalisierung den Umweltschutz unterstützt
Konsequente Digitalisierung – der Umwelt zuliebe
Als Treiber für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung führt kein Weg an der Digitalisierung vorbei. Mehr noch, sie kann und muss die miserable CO2-Bilanz vieler Industriezweige verbessern. Das gelingt allerdings nur, wenn die IT-Branche ein nachhaltiges Design vorantreibt und die Unternehmen ihre Beschaffungsmodelle überdenken. Stellschrauben gibt es zur Genüge.
Der Green Deal ist die vielleicht ehrgeizigste Agenda, die sich die EU je vorgegeben hat. Bis 2050 wollen die 27 Mitgliedstaaten klimaneutral werden. Dabei sollen in einem ersten Schritt die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 sinken – ein Ziel, das nicht ohne grundlegende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erreicht werden kann.
Gleichzeitig setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Schritt hin zur Klimaneutralität ohne Digitalisierung scheitern wird. Technologie nämlich spielt bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten – etwa der Energiewende – eine Schlüsselrolle. Windkraftanlagen und Photovoltaikmodule müssen koordiniert werden, um zu wissen, wann Strom fließt, wo angesichts schwankender Wetterbedingungen eine Regulierung notwendig ist und welche Abnehmer im Zweifel für eine gewisse Zeit darauf verzichten können. Diese Steuerung übernehmen im Rahmen eines Smart-Grid-Konzepts leistungsstarke Rechner und Netze.
Die Digitalisierung ist Chance und Risiko zugleich
Digitale Lösungen helfen aber auch, Äcker präzise zu düngen, den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren und damit die Artenvielfalt zu schützen. Ein großer Teil des Düngers, der bei der Herstellung viel Energie braucht, landet auf nicht bepflanzten Flächen oder wird ausgespült. Nicht viel anders sieht es beim Ausbringen von Pestiziden aus: Anstatt der befallenen Stellen wird normalerweise das komplette Feld besprüht. Mithilfe von Sensoren, Algorithmen und GPS-Kameratechnik lassen sich jedoch erkrankte oder von Schädlingen befallene Pflanzen präzise orten, um dann Düngemittel und Unkrautvernichter punktgenau aufzubringen.
Einen Schritt weiter geht das sogenannte Indoor Farming – hier wächst das Gemüse beispielsweise in übereinander gestapelten Containern. Mikrosensoren messen laufend die Temperatur, die Feuchtigkeit sowie den Sauer- und Nährstoffgehalt, um jeder Pflanze ideale Bedingungen zu verschaffen – ganz ohne den Einsatz von irgendwelchen Giften. Werden zudem Lebensmittel dort produziert, wo sie auch konsumiert werden, etwa auf dem Flachdach eines Supermarkts, fallen schädliche Emissionen durch den Warentransport weg.
Natürlich verbraucht die Herstellung der Drohnen und Sensoren zunächst einmal Energie, genauso wie die Implementierung der Infrastruktur und das Aufsetzen der Anwendung. Unterm Strich wird der CO2-Ausstoß und damit die Umweltbelastung aber deutlich reduziert.
Fakt ist: Die Digitalisierung ist für den Klimaschutz Chance und Risiko zugleich: Einerseits können moderne Lösungen dazu beitragen, die Klimabilanz zum Positiven zu entwickeln. Andererseits ist Informations- und Kommunikationstechnologie selbst in wachsendem Maße für den Anstieg des weltweiten Energie- sowie Ressourcenverbrauchs und damit den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verantwortlich.
Zuviel Digitalisierung kann das Ziel der „Grünen Null“ also gefährden – sofern die Transformation nicht stärker in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. Allerdings hat die IT-Industrie, und nicht nur sie, zahlreiche Stellschrauben, um die CO2-Bilanz zu verbessern und dem Klima etwas Gutes zu tun.
Stellschraube Energieeffizienz: Je niedriger der Stromverbrauch, desto besser die Klimabilanz
Ein Großabnehmer von Strom sind Rechenzentren. Laut einer Bitkom-Studie liegt der Bedarf aktuell bei 16 Milliarden kWh im Jahr. Doch während die Kapazität – gemessen an der IT-Leistung – von 2010 bis 2020 um 84 Prozent gestiegen ist, hat der tatsächliche Stromverbrauch zwar ebenfalls zugelegt, aber nicht einmal ansatzweise im gleichen Tempo: So hat sich die Zahl der installierten Workloads pro Kilowattstunde Strom seit 2010 verfünffacht.
Moderne Rechenzentren erreichen heute mit PUE-Werten (Power Usage Effectiveness) zwischen 1,1 und 1,4 bereits eine sehr gute Energieeffizienz – nur ein kleiner Teil ihres Verbrauchs entfällt auf die Infrastruktur zur Stromversorgung oder die Kühlung der IT-Systeme. CO2-Einsparmöglichkeiten gibt es allerdings noch bei der benötigten Energie, die oftmals nicht aus regenerativen Quellen stammt. Soll das von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgeschriebene Ziel, ab 2027 nur noch klimaneutrale Rechenzentren neu in Betrieb zu nehmen, erreicht werden, kommt die Branche an einer vollständigen Versorgung mit Strom aus Wind-, Wasser- oder Sonnenkraft nicht vorbei.
Richtig viel Potenzial steckt zudem in der Nutzung der Abwärme von Rechenzentren. Lediglich ein Bruchteil der für die Bitkom-Studie Befragten speist die industrielle Abwärme bislang in die Fernwärmeversorgung von Wohnungen und Gebäuden ein. Der Grund liegt an fehlenden Abnehmern (56 Prozent) und geringer Wirtschaftlichkeit (52 Prozent).
Stellschraube Rohstoffe: Wo es keine nachhaltigen Alternativen gibt, muss konsequent recycelt werden
Die IT-Branche hängt zudem stark von wertvollen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Lithium oder Platin ab, die oftmals nicht nachhaltig sind und einen hohen Energie- und Wasserverbrauch bei ihrer Gewinnung verursachen. Viele Stufen des Wertschöpfungsprozesses eines Produkts finden zudem in unterschiedlichen Ländern mit ihren jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen statt – auf globale Lieferketten können Unternehmen aber nicht immer direkt Einfluss nehmen.
Aus der Verantwortung kann sich die IT-Industrie dennoch nicht stehlen, sondern muss ihren ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen hinweg weiter verbessern. Hier hat sich in den vergangenen Jahren gerade bei Alternativen zu den bislang verwendeten Materialien viel getan: So werden beispielsweise recycelte Kohlefasern aus der Luft- und Raumfahrtindustrie als Polycarbonat-Basis für die Herstellung von Laptops verwendet.
Eine Alternative sind Gehäuse aus Bio-Kunststoffen, die aus Baumabfällen bei der Papierherstellung gewonnen werden.
Nicht jeder Rohstoff lässt sich allerdings so einfach ersetzen. Umso wichtiger ist es, wertvolle Metalle und Seltene Erden, die sich in ausgedienten Elektronikartikeln verstecken, wieder zu verwenden. Wenn man sich einmal vor Augen führt, dass eine Tonne an Festplatten 800-mal mehr Gold enthält als die gleiche Menge an abgebauten Golderzen, erkennt man die Bedeutung eines geschlossenen Rohstoff-Kreislaufs.
Hier ist vor allem die IT-Industrie gefordert, jeden Schritt im Recycling-Prozess zu optimieren. Eine einfache Demontage, ein minimaler Einsatz von Klebstoff und Schrauben sowie die Vermeidung unnötiger Lackierungen sind dabei Voraussetzung, um die Arbeit der Wiederverwerter zu erleichtern.
Stellschraube Lebenszyklus: Muss die IT alle zwei Jahre ausgetauscht werden?
Obwohl die Rechenleistung längst nicht mehr exponentiell steigt, ist der Lebenszyklus eines Rechners seit Anfang der 1990er von durchschnittlich sieben Jahren auf heute zwei Jahre gesunken. Dabei gehen die Geräte nicht früher kaputt, sondern werden wegen geringerer Kosten lediglich häufiger durch leistungsfähigere Modelle ersetzt.
Dabei gibt es eine einfache Faustregel: Je länger ein Gerät im Einsatz ist, desto besser ist es für die Umwelt. Damit dies gelingt, müssen Hersteller dafür sorgen, dass Hardware für zukünftige Anforderungen aufgerüstet werden kann, um fortlaufende Neuanschaffungen zu vermeiden. Zudem müssen Anwender einen einfacheren Zugang zu Ersatzteilen erhalten, damit wieder mehr repariert und weniger ausgetauscht wird. Unternehmen, die angesichts ihrer geschäftlichen Anforderungen stets auf eine leistungsstarke IT-Infrastruktur angewiesen sind, sollten bereits beim Kauf eine mögliche Weiterverwendung im Blick haben.
Das heißt, passt nach ein paar Jahren die Performance der Hardware nicht mehr, können die Geräte refurbished ein zweites Leben in weniger anspruchsvollen Umgebungen wie einem Trainingsraum finden. Und auch danach muss der Lebenszyklus der IT keineswegs zu Ende sein: Schulen mit schlechter Ausrüstung oder Wohltätigkeitsvereine freuen sich über eine Spende. Gebrauchte Rechner irgendwo im Keller zu lagern, ist sicher keine nachhaltige Art, mit IT-Assets umzugehen.
Ein Klimakiller ist die Digitalisierung also definitiv nicht, ganz im Gegenteil – richtig eingesetzt, kann sie einen wesentlichen Beitrag leisten, um die CO2-Emissionen in Industrie, Verkehr und der Gesellschaft ganz allgemein zu verringern. Die Politik hat inzwischen die Nachhaltigkeitsziele für Unternehmen enorm verschärft. Jetzt müssen Industrie und Wirtschaft ihre Einkaufspolitik soweit es geht umweltverträglich gestalten. Die IT-Branche wiederum ist gefordert, kontinuierlich an Lösungen mit einer besseren Klimabilanz zu arbeiten.
Autor: Emanuel Lippmann, Global Program Manager Social Impact, Dell Technologies