Cloud-Computing gilt als Innovationstreiber der Digitalisierung, doch die wachsenden Datenmengen haben ihren ökologischen Preis: Rechenzentren verursachen bereits mehr als ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen – Tendenz steigend. Bislang fehlte es jedoch an einheitlichen Methoden, um die Umweltauswirkungen einzelner Cloud-Dienste zu messen und zu vergleichen.
Wissenschaftler des Öko-Instituts und des Fraunhofer IZM haben erstmals eine ganzheitliche Methodik entwickelt, die den Umweltfußabdruck von Cloud-Diensten über den gesamten Lebenszyklus erfasst – vom Energieverbrauch über die Treibhausgase bis hin zu Wasser- und Rohstoffeinsatz. Damit lässt sich die ökologische Performance verschiedener Anbieter und Systeme erstmals vergleichen.
Die Ergebnisse zeigen eine große Bandbreite: Ein Terabyte Online-Speicher verursacht pro Jahr – je nach Anbieter – zwischen 166 und 280 Kilogramm CO2. Eine Videokonferenz schlägt mit moderaten 2,3 Gramm CO2 pro Stunde und Teilnehmer zu Buche, mit Endgeräten und Übertragungsnetzen steigt die Bilanz jedoch auf bis zu 295 Gramm.
Digitale Suffizienz ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit
Digitalisierung ist nicht per se nachhaltig. Jede eingesparte Kilowattstunde durch effizientere Cloud-Systeme wird durch Rebound-Effekte oft direkt wieder aufgefressen. Neben technologischen Innovationen braucht es daher auch ein Umdenken bei Anbietern und Nutzern hin zu „digitaler Suffizienz“ – also einem maßvollen Einsatz von IT-Ressourcen.
Auch die Politik spielt eine Rolle: Ambitionierte Vorgaben zu Energiemanagement, Ressourceneinsatz und Kreislaufwirtschaft können Investitionen in „grüne“ Rechenzentren fördern. Als Schritt in die richtige Richtung gilt das neue Energieeffizienzgesetz (EnEfG). Gemäß den EU-Vorgaben verpflichtet es die Betreiber von Rechenzentren, ihren Stromverbrauch ab 2027 bilanziell zu hundert Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken.
International setzen Vorreiter wie Google und Microsoft bereits Standards für eine nachhaltige Cloud. Die EU gibt mit dem European Green Deal und Initiativen wie dem EU Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centres den Rahmen vor. Im globalen Wettbewerb erweist sich Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal.
Entwickler setzen auf „Green Coding“ und ressourcenschonende Software
Doch nicht nur die Cloud-Infrastruktur, sondern auch die Software selbst rückt in den Fokus. Unter Sammelbegriffen wie Green Coding arbeiten Entwickler an ressourcenschonenden Praktiken der Programmierung. Hier helfen Open-Source-Lösungen und modulare Architekturen. Künftig müssen Nachhaltigkeitsaspekte von Anfang an in die Entwicklung einfließen.
Der Weg zur „grünen Cloud“ erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Alle Akteure – Anbieter, Nutzer und Politiker – sind gefordert, verantwortungsvoll und innovativ mit der Ressource Digitalisierung umzugehen. Die neuen Umweltkennzahlen schaffen dafür eine wichtige Grundlage. Sie machen Nachhaltigkeit in der Cloud messbar und vergleichbar. Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, kann die Cloud zum Vorbild für eine rundum nachhaltige Digitalisierung werden.
Kube-Green & Karpenter: Dynamisches Duo für die Green Cloud

Die Open-Source-Projekte Kube-Green und Karpenter ergänzen sich perfekt, um Kubernetes-Cluster energieeffizient und ressourcenoptimiert zu betreiben:
- Setzt Pods automatisch aus, wenn sie nicht genutzt werden
- Reduziert den Energieverbrauch und die Kosten auf Pod-Ebene
- Green Dashboard zur Visualisierung der Energieeinsparungen
- Skaliert die Cluster-Infrastruktur automatisch und entfernt unterforderte Nodes
- Optimiert die Ressourcennutzung auf Cluster-Ebene und vermeidet Überprovisionierung
- Verbessert die Anwendungsverfügbarkeit durch schnelle Reaktion auf Lastveränderungen
Zusammen erreichen sie eine ganzheitliche Optimierung, die den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduziert, Kosten senkt und den Verwaltungsaufwand minimiert. Ein Meilenstein für energieeffizientes und umweltfreundliches Cloud-Computing.
Cloud-Anbieter: Wegbereiter für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft
Die Cloud bietet nicht nur Potenzial für mehr Energieeffizienz, sondern kann auch eine wichtige Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen. Durch die gemeinsame Nutzung von IT-Ressourcen lässt sich die Auslastung von Hardware erhöhen und ihre Lebensdauer verlängern. Auch das Teilen und Wiederverwenden von Software gelingt leichter.
Allerdings entstehen an anderer Stelle neue Herausforderungen: Der ständige Drang nach mehr Leistung und Speicherplatz führt zu einem schnelleren Austausch von Servern und Komponenten. Hier müssen Konzepte her, die sicherstellen, dass ausgediente Hardware möglichst lange weiterverwendet, repariert oder recycelt wird.
Hyperscaler wie Google gehen mit gutem Beispiel voran. So verwendete Google bereits 2016 nach eigenen Angaben für 36 Prozent der bereitgestellten Server wiederaufbereitete Geräte. Mehr als 2,1 Millionen ausgemusterte Geräte wurden damals weiterverkauft und von anderen Organisationen produktiv wiederverwendet. Ziel ist eine „Zero Waste“-Cloud, in der kein Elektroschrott mehr anfällt.
Damit dies gelingt, müssen Nachhaltigkeitsaspekte schon beim Design von IT-Equipment und Rechenzentren Berücksichtigung finden. Zu den Stichworten zählen hier: Modularität, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit.
Nachhaltige Digitalisierung braucht Zusammenspiel aller Akteure
Unternehmen sollten ihre Beschaffung an Nachhaltigkeitskriterien ausrichten und bei Cloud-Anbietern gezielt nach Umweltstandards und Recyclingquoten fragen. Auch eine effiziente Auslastung der genutzten Cloud-Ressourcen will gelernt sein. Am Ende braucht es ein Zusammenspiel aller Akteure, um die Digitalisierung in nachhaltige Bahnen zu lenken. Die Wirtschaft sollte mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen vorangehen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen und Anreize für Investitionen in „grüne“ IT schaffen.
Aber auch die Verbraucher können durch ihr Nutzungsverhalten und ihre Kaufentscheidungen ein wichtiges Zeichen setzen. Umweltkennzeichnungen nach DIN ISO 14025, wie sie das Öko-Institut für Cloud-Dienste vorschlägt, würden hier die nötige Transparenz schaffen. Auch Bildung für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Ressourcen spielt eine immer wichtigere Rolle.
Wissenschaft liefert mit Forschung die Faktengrundlage für „grüne“ IT
Nicht zuletzt ist die Wissenschaft gefragt, mit Forschung und Fakten die Grundlage für informierte Entscheidungen zu liefern. Projekte wie „Green Cloud Computing“ leisten hier wertvolle Pionierarbeit. Sie zeigen, dass sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht ausschließen müssen, sondern im Gegenteil sogar befeuern können.
Denn richtig eingesetzt kann die Cloud zum Motor einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft werden – einer Wirtschaft, die natürliche Ressourcen möglichst lange im Kreislauf führt, Abfall vermeidet und Emissionen minimiert. Damit dies gelingt, müssen allerdings auch IT-Verantwortliche, Admins und Software-Entwickler die Chancen der Digitalisierung beherzt ergreifen und in die richtigen Bahnen lenken.
Kepler: Schlüsseltechnologie für die Green Cloud
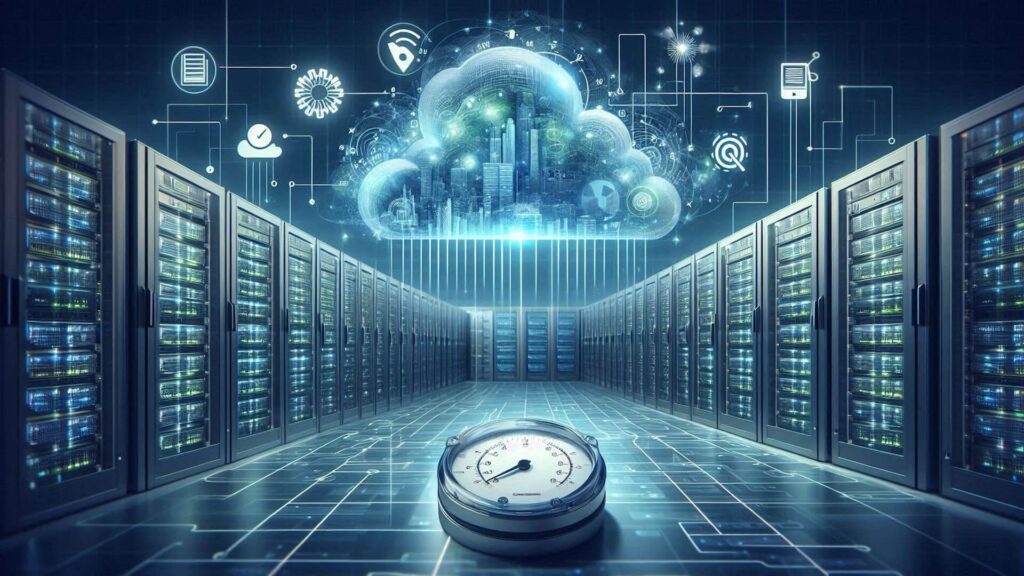
- Granulare Energiemessung auf Prozess-, Container- und Pod-Ebene
- Echtzeit-Monitoring des Energieverbrauchs via eBPF und Hardware-Counter
- Präzise Schätzungen durch Machine-Learning-Modelle
- Integration verschiedener Datenquellen (RAPL, ACPI, Redfish, NVML)
Durch diese Funktionen schafft Kepler Transparenz und Optimierungspotenzial für den Energieverbrauch in Cloud-Umgebungen. Unternehmen können so ihre Rechenzentren und Cloud-Workloads effizienter gestalten, den CO2-Fußabdruck reduzieren und einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Cloud-Infrastruktur gehen.
Mit der „grünen Cloud“ auf dem Weg zur nachhaltigen Digitalisierung
Cloud und künstliche Intelligenz sind zweischneidige Schwerter der digitalen Transformation: Einerseits ermöglichen sie enorme Effizienzgewinne, andererseits befeuern sie den Energie- und Ressourcenhunger. Umso wichtiger ist es, diese Schlüsseltechnologien auf Nachhaltigkeitskurs zu bringen.
Umweltkennzahlen helfen dabei. Sie schaffen Transparenz und ermöglichen den Vergleich von Cloud-Diensten. Auf dieser Basis können verbindliche Standards und Selbstverpflichtungen der Anbieter den Weg zu einer ressourcenschonenden, kreislauforientierten „grünen Cloud“ beschleunigen.
Parallel müssen Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltzeichen wie der Blaue Engel zum Bestandteil der Software-Entwicklung werden. Öko-Design, Energieeffizienz und Ressourcenschonung gehören in den Werkzeugkasten jedes Entwicklers. Auch künstliche Intelligenz , Blockchain & Co. müssen sich daran messen, was sie zu einer nachhaltigeren Digitalisierung beitragen.
Als Rückgrat der digitalen Welt kann die Cloud durchaus zum Vorbild und Motor der grünen Transformation avancieren. Es gilt, dieses Potenzial mit Innovationsgeist, politischem Gestaltungswillen und einem neuen Bewusstsein aller Beteiligten zu heben. So gelingt es, die „grüne Cloud“ zum Leuchtturm einer lebenswerten digitalen Zukunft im Einklang mit Mensch und Natur zu machen.
Autor: Stefan Kuhn

